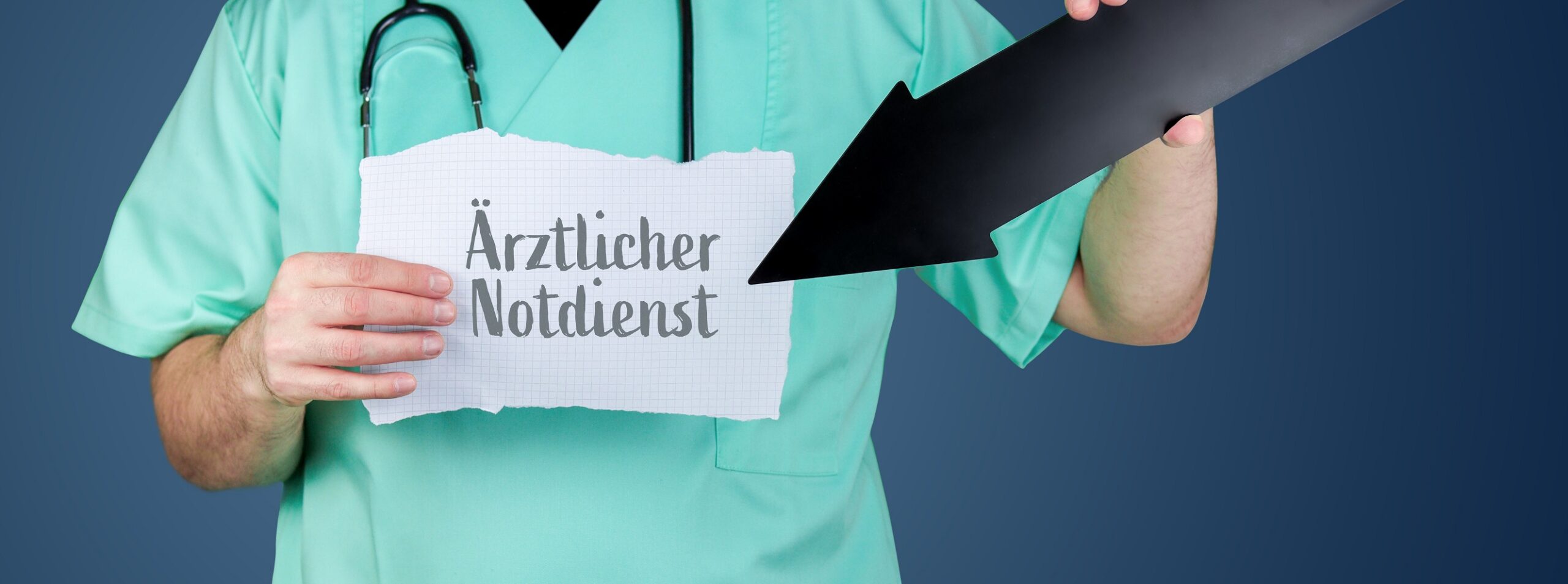11. August 2025
Betriebsvermögen in Arztpraxen steuerlich richtig einordnen
Ob Investitionen in medizinische Geräte, Praxisräume oder Fahrzeuge – für selbständige Ärzt:innen stellt sich häufig die Frage, welche Wirtschaftsgüter zum Praxis- bzw. Betriebsvermögen zugeordnet werden sollten.
Eine korrekte Zuordnung ist steuerlich von großer Bedeutung: Sie beeinflusst nicht nur die Höhe der Abschreibungen, sondern auch die Anerkennung von Betriebsausgaben und letztlich die Ermittlung des zu versteuernden Gewinns. Auch kann sie bei einer späteren Praxisveräußerung oder –aufgabe von Bedeutung sein.
Doch welche Unterschiede gibt es bei Einzelpraxen und Gemeinschaftspraxen. Wie sieht es bei Mitunternehmerschaften aus?
Dieser Beitrag gibt einen praxisnahen Überblick über die verschiedenen Vermögensarten und zeigt auf, welche steuerlichen Folgen sich aus ihrer jeweiligen Einordnung ergeben.
Betriebsvermögen in der Arztpraxis: Was gehört dazu?
Unter Betriebsvermögen – im ärztlichen Kontext auch Praxisvermögen genannt, sind alle Wirtschaftsgüter eines Unternehmens, die für betriebliche Zwecke genutzt werden zu verstehen. Darunter fallen:
- Praxisräume
- Medizinische Geräte
- EDV-Ausstattung
- Fahrzeuge
- Immaterielle Güter wie Software oder Lizenzen
Entscheidend ist der Nutzungszweck – und nicht etwa, ob die Anschaffung über das Praxiskonto oder privat finanziert wurde. Je nach Nutzungsumfang unterscheidet man zwischen drei Vermögensarten.
Drei Kategorien von Praxisvermögen: So wird unterschieden
Grundsätzlich wird zwischen drei Formen des Vermögens unterschieden:
- Notwendiges Betriebsvermögen (Praxisvermögen)
- Notwendiges Privatvermögen
- Gewillkürtes Betriebsvermögen
1. Notwendiges Betriebsvermögen (Praxisvermögen):
Ein notwendiges Betriebsvermögen umfasst alle Wirtschaftsgüter, die fast ausschließlich (mehr als 50 %) für den Praxisbetrieb genutzt werden. In der Praxis bedeutet das: Wenn ein Ultraschallgerät, ein Behandlungsstuhl oder ein EKG-Gerät regelmäßig in der Patientenversorgung eingesetzt wird, gehört es zum Betriebsvermögen. Dabei ist es nicht entscheidend, ob das Gerät mit privaten Mitteln oder mit dem Praxiskonto bezahlt wurde – sondern, ob es tatsächlich der Ausübung von ärztlichen Behandlungen dient.
2. Notwendiges Privatvermögen:
Hierunter fallen Wirtschaftsgüter, die ausschließlich privat genutzt werden (unter 10%) – etwa ein Fernseher in der privaten Wohnung oder das Fahrrad für die Freizeit. Auch wenn diese Gegenstände möglicherweise gelegentlich einen beruflichen Nutzen haben, reicht das nicht aus, um sie dem Betriebsvermögen zuzuordnen.
3. Gewillkürtes Betriebsvermögen:
Zwischen diesen beiden Extremen liegt das gewillkürte Betriebsvermögen. Das betrifft Gegenstände, deren betriebliche Nutzung zwischen 10 – 50 % liegt. In diesem Bereich hat der Praxisinhaber einen gewissen Spielraum: Er kann entscheiden, ob er das Wirtschaftsgut dem Betriebsvermögen zuordnen möchte – vorausgesetzt, es besteht ein sachlicher Zusammenhang zur Praxis. Die Wirtschaftsgüter können dann abgeschrieben und als Betriebsausgabe angesetzt werden, was zu einer Senkung der persönlichen Steuerlast führt. Wird das Wirtschaftsgut jedoch wieder verkauft, wird der aus dem Verkauf resultierende Gewinn der Praxis zugeordnet. Wichtig ist, dass diese Entscheidung dokumentiert wird, zum Beispiel durch eine Eintragung im Anlagenverzeichnis der Praxis. Bei einer falschen Zuordnung oder mangelnder Dokumentation kann dies zu steuerlichen Nachteilen und Nachzahlungen führen.
Besonderheiten je nach Praxisform
Einzelpraxis: Entscheidungsspielräume gezielt nutzen
Das Betriebsvermögen in der Einzelpraxis umfasst alle Wirtschaftsgüter, die für das Betreiben der Praxis bestimmt sind und zur Erzielung von Einkünften (hier Einkünfte aus selbständiger Arbeit) dienen. Diese Wirtschaftsgüter werden einer der drei Formen des Vermögens zugeordnet, also dem notwendigen Betriebsvermögen (Praxisvermögen), gewillkürtem Betriebsvermögen oder notwendigem Privatvermögen. Besonders bei Einlagen und Entnahmen im Betriebsvermögen bestehen Besonderheiten, die zu beachten sind.
Ein klassisches Beispiel: Sie erwerben aus privaten Mitteln ein neues Ultraschallgerät, das ausschließlich in Ihrer Praxis genutzt wird. Das Gerät gehört aufgrund der Nutzung zum Betriebsvermögen, auch wenn es mit ihrem Privatkonto bezahlt wurde. In diesem Fall erfolgt eine Einbuchung als Privateinlage. Ab diesem Zeitpunkt können Sie das Gerät über die festgelegte gewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben und sämtliche laufenden Kosten als Betriebsausgabe absetzen.
Ähnlich verhält es sich mit Praxisräumen innerhalb der eigenen Immobilie. Wird ein Raum zu mehr als 50 % für berufliche Zwecke genutzt – z. B. als Behandlungszimmer –, gehört dieser Anteil zum notwendigen Betriebsvermögen. Wird der Raum dagegen gemischt genutzt, kommt unter Umständen gewillkürtes Betriebsvermögen in Betracht – mit der Möglichkeit, den betrieblichen Teil freiwillig ins Betriebsvermögen aufzunehmen. Die Entscheidung sollte allerdings gut überlegt sein: Eine spätere Entnahme löst unter Umständen eine Entnahmebesteuerung aus, insbesondere wenn stille Reserven aufgebaut wurden (z. B. durch Wertsteigerung der Immobilie). Zudem kann eine Immobilie, die (zum Teil) Betriebsvermögen darstellt –anders als Immobilien im Privatvermögen- nicht nach zehn Jahren steuerfrei verkauft werden.
Berufsausübungsgemeinschaft: Vermögen richtig zuordnen
In der Berufsausübungsgemeinschaft unterscheidet man:
- Gesamthandsvermögen: gemeinsam angeschaffte Praxisgüter wie Geräte oder Software
- Sonderbetriebsvermögen: individuelle Wirtschaftsgüter eines Gesellschafters, etwa privat finanzierte Geräte oder vermietete Praxisräume
Zum Gesamthandsvermögen gehören alle Wirtschaftsgüter, die im gemeinschaftlichen Eigentum der Praxis stehen. Dazu zählen beispielsweise medizinische Geräte, die gemeinschaftlich angeschafft wurden, die gemeinsame Praxissoftware oder gemeinsames Mobiliar. Diese Gegenstände sind unmittelbarer Teil des Betriebsvermögens der Gemeinschaftspraxis.
Anders verhält es sich mit dem Sonderbetriebsvermögen. Dieses umfasst Wirtschaftsgüter, die im Eigentum eines einzelnen Gesellschafters stehen und entweder der Gemeinschaftspraxis überlassen oder durch den einzelnen Gesellschafter zur Ausübung seiner Tätigkeit in der Praxis verwendet werden. Ein klassisches Beispiel ist das Praxisgebäude, das einem Gesellschafter gehört und an die Berufsausübungsgemeinschaft überlassenwird. Auch medizinische Geräte, die ein Arzt aus eigenem Vermögen beschafft hat und der Praxis zur Nutzung zur Verfügung stellt zählen dazu. Diese Güter sind steuerlich dem jeweiligen Gesellschafter zuzuordnen, obwohl sie im Betrieb der Gemeinschaft dienen.
Hier wird auch nochmals zwischen notwendigem und gewillkürtem Sonderbetriebsvermögen unterschieden.
- Notwendiges Sonderbetriebsvermögen I liegt vor, wenn das Wirtschaftsgut ausschließlich und unmittelbar dem Betrieb der Gemeinschaftspraxis dient. Dazu gehört etwa das oben genannte Praxisgebäude oder ein ausschließlich beruflich genutztes Fahrzeug.
- Notwendiges Sonderbetriebsvermögen II liegt dann vor, wenn das Wirtschaftsgut zur Begründung oder Stärkung der Beteiligung an der Gemeinschaftspraxis eingesetzt wird – zum Beispiel, wenn ein Gesellschafter ein Darlehen aufnimmt, um seinen Anteil an der Praxis zu finanzieren.
- Gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen liegt – wie bei der Einzelpraxis – dann vor, wenn das Wirtschaftsgut nur teilweise betrieblich genutzt wird, aber ein Zusammenhang mit der Praxis besteht. Auch hier kann der Gesellschafter entscheiden, ob er das Gut dem Betriebsvermögen zuordnen möchte.
Sonderbilanzen und Ergänzungsbilanzen
Wenn ein Gesellschafter einer Praxisgemeinschaft Wirtschaftsgüter in Form von Sonderbetriebsvermögen einbringt, müssen diese in einer sogenannten Sonderbilanz erfasst werden. Diese Bilanz existiert ausschließlich zu steuerlichen Zwecken und ist handelsrechtlich nicht relevant. Jeder Gesellschafter führt hierbei eine eigene Sonderbilanz, in der seine eingebrachten Wirtschaftsgüter und deren Entwicklung nachvollzogen werden.
Kommt es zu einem Gesellschafterwechsel, etwa durch Eintritt eines neuen Arztes, kann es zudem notwendig sein, eine Ergänzungsbilanz zu erstellen. Diese enthält steuerliche Korrekturen zu den Buchwerten der gemeinschaftlich gehaltenen Wirtschaftsgüter. Wenn der neue Gesellschafter etwa einen höheren Kaufpreis für seinen Anteil zahlt als der Buchwert der übernommenen Vermögenswerte, wird der Differenzbetrag in einer positiven Ergänzungsbilanz erfasst. Wird weniger gezahlt als der Buchwert, entsteht eine negative Ergänzungsbilanz.
Die hieraus entstehenden steuerlichen Auswirkungen – etwa in Form zusätzlicher Abschreibungen – werden wiederum in einer sogenannten Ergänzungs-Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) berücksichtigt.
Praxisgemeinschaft: Klare Eigentumsverhältnisse erforderlich
Bei einer Praxisgemeinschaft schließen sich mehrere (Zahn-)Ärztinnen organisatorisch zusammen, um Räumlichkeiten, Personal und Praxisinventar effizient gemeinsam zu nutzen. Wichtig ist jedoch: Jeder Beteiligte führt eine eigene Einzelpraxis – mit eigenem Patient:innenstamm, eigener Abrechnung und eigenständiger steuerlicher Gewinnermittlung. Es handelt sich nicht um eine gemeinsame Praxis im rechtlichen oder steuerlichen Sinne, sondern um getrennte wirtschaftliche Einheiten unter einem Dach.
Diese Struktur bringt besondere Herausforderungen in der Zuordnung und Behandlung von Betriebsvermögen mit sich:
- Jeder Arzt bzw. jede Ärztin verfügt über eigenes Praxis- bzw. Betriebsvermögen. Es gibt kein gemeinschaftliches Gesamthandsvermögen, wie es bei Berufsausübungsgemeinschaften der Fall ist. Das bedeutet: Wirtschaftsgüter, die gemeinsam genutzt werden – etwa medizinische Geräte, das Wartezimmermobiliar oder die EDV – müssen anteilig oder einzeln in den jeweiligen Praxen bilanziert oder im Anlagenverzeichnis erfasst werden. Voraussetzung dafür ist eine klare vertragliche Regelung zur Eigentumsverteilung oder Nutzungsüberlassung.
- Wird z. B. ein digitales Röntgengerät gemeinschaftlich angeschafft und von zwei Zahnärzt:innen jeweils zur Hälfte genutzt, muss jeder den eigenen Anteil im Betriebsvermögen erfassen und entsprechend abschreiben. Der Anteil kann als Miteigentum (bei gemeinsamer Anschaffung) oder über ein Nutzungsentgelt (bei einseitigem Eigentum) abgebildet werden.Erfolgt keine eindeutige vertragliche Klärung, besteht das Risiko, dass das Finanzamt die Betriebsausgaben anteilig kürzt oder steuerlich nicht anerkennt. Gerade bei teuren Geräten oder immobiliennahen Vermögenswerten wie Praxiseinbauten kann das erhebliche Auswirkungen haben.
Spezialfall: Pkw im Betriebsvermögen
Als niedergelassener Arzt oder Ärztin stellt sich früher oder später die Frage: Wie gehe ich steuerlich mit meinem privat genutzten Auto um, wenn ich es auch für meine Praxis verwende? Hausbesuche, Fahrten zu Fortbildungen, oder ins Labor gehören schließlich zu den alltäglichen Tätigkeiten – doch wie wirkt sich dies steuerlich aus?
Wird das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich genutzt, müssen Sie es dem Betriebsvermögen zuordnen. Nehmen wir an, Sie haben eine jährliche Fahrleistung von 10.000 km und 6.000 km entfallen auf die betrieblich veranlassten Fahrten. Die betriebliche Nutzung Ihres PKWs liegt dann bei 60 %. In diesem Fall besteht die Erfordernisdas Fahrzeug vollständig in das Betriebsvermögen aufzunehmen.
Ihre Vorteile:
- Sie können den gesamten Kaufpreis über die Nutzungsdauer abschreiben
- Alle laufenden Kfz-Kosten (Tanken, Versicherung, Wartung) sind steuerlich absetzbar
Entscheiden Sie sich für diesen Weg, muss Ihre private Nutzung jedoch versteuert werden – entweder über ein Fahrtenbuch oder mittels der pauschalen 1%-Regelung auf Basis des Bruttolistenpreises. Bei Elektrofahrzeugen gibt es auch günstigere Alternativen als die 1%-Besteuerung.
Alternativ kann das Auto im Privatvermögen bleiben und Sie können die betrieblichen Fahrten steuerlich geltend machen. Dies wäre mit einem Fahrtenbuch oder der Kilometerpauschale möglich. Diese Variante ist dann sinnvoll, wenn:
- Der betriebliche Nutzungsanteil unter 50 % liegt, oder
- Sie den Verwaltungsaufwand eines Fahrtenbuchs oder Entnahmebesteuerung umgehen möchten. Bei dieser Variante darf die betriebliche Nutzung aber nicht mehr als 50% betragen.
Praxisnahe Beispiele mit Immobilien
Beispiel:
Sie erwerben ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 3 gleichgroßen Einheiten:
- Erdgeschoss: wird vollständig als Arztpraxis genutzt
- 1. Obergeschoss: Ihre selbstgenutzte Wohnung
- Dachgeschoss: eine von Ihnen vermietete Wohnung
Das Erdgeschoss stellt notwendiges Betriebsvermögen dar, da es betrieblich – also zur Behandlung von Patienten: innen genutzt wird.
Das 1. Obergeschoss stellt Privatvermögen dar, da es der privaten Nutzung dient. Dieses darf nicht bilanziert werden. Renovierungsarbeiten bspw. hierfür können aber steuerlich nach § 35a Abs. 3 EStG geltend gemacht werden.
Die vermiete Wohnung im Dachgeschoss stellt gewillkürtes Betriebsvermögen zu fremden Wohnzwecken dar. Aufgrund des Wahlrechts besteht die Möglichkeit das Dachgeschoss dem Betriebsvermögen zuzuordnen und zu bilanzieren, oder es dem Privatvermögen zuzuordnen. Bei Zuordnung der Wohnung zum Betriebsvermögen wären die Mieteinnahmen betrieblich zu erfassen. Neben der Einkommensteuer wäre dann noch Gewerbesteuer zu zahlen. Zudem wären die stillen Reserven der Immobilie durch z.B. Veräußerung oder Entnahme zu versteuern. Bei einer Zuordnung zum Privatvermögen wäre die Wohnung nur in der Einkommensteuer zu erfassen. Im Regelfall sollte dieses Wahlrecht bei privaten Immobilien jedoch nicht genutzt werden, da diese dann “steuerverstrickt” sind und im Falle der Veräußerung die stillen Reserven zwischen dem Zeitpunkt der Einlage und der Veräußerung zu versteuern sind. Dies gilt auch im Falle einer Praxisaufgabe (weil die Immobilie dann wieder in das Privatvermögen überführt wird) oder Praxisveräußerung.
Typische Fehler und ihre steuerlichen Folgen
Eine falsche Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum Betriebs- oder Privatvermögen kann für erhebliche steuerliche und finanzielle Konsequenzen sorgen:
1.Verlust von Betriebsausgaben und Abschreibungen
Wenn ein Wirtschaftsgut (z. B. ein medizinisches Gerät oder Fahrzeug) zu Unrecht nicht dem Betriebsvermögen zugeordnet wird, können Abschreibungen und laufende Betriebsausgaben (z. B. Wartung, Versicherung, Reparaturen) steuerlich nicht geltend gemacht werden, was zu erhöhten Steuerzahlungen führt.
2. Steuerpflichtige Entnahme bei fehlerhafter Zuordnung ins Betriebsvermögen
Wird ein privat genutztes Wirtschaftsgut zu Unrecht dem Betriebsvermögen zugeordnet (z. B. ein Pkw, der kaum für Praxisfahrten genutzt wird), kann dies bei späterer „Entnahme“ aus der Praxis steuerpflichtig werden. Durch eine Versteuerung der Entnahme zum Teilwert kann dies bei einer Wertsteigerung des Wirtschaftsgutes zu einer erheblichen Steuerlast führen. Zudem sind sämtliche Ausgaben, die im Zusammenhang mit diesem Wirtschaftsgut stehen, nicht abziehbar.
3. Rückwirkende Korrekturen und Hinzurechnungen durch das Finanzamt
Stellt das Finanzamt bei einer Betriebsprüfung fest, dass ein Wirtschaftsgut falsch zugeordnet wurde, kann es zu rückwirkenden Korrekturen kommen, wie z.B. gewinnerhöhende Streichung von Praxisausgaben oder der Nachversteuerung stiller Reserven.
4. Schwierigkeiten beim Praxisverkauf oder -übergabe
Eine unklare oder inkonsistente Vermögenszuordnung kann bei Praxisverkäufen oder Übergaben zu rechtlichen und steuerlichen Problemen führen. Käufer:innen oder Nachfolger:innen benötigen eine saubere Abgrenzung des betriebsnotwendigen Vermögens. Fehler können hier zu Verlusten beim Kaufpreis oder steuerlichen Nachteilen führen – etwa durch falsche Buchwerte oder verdeckte stillen Reserven.
Unsere Einschätzung
Die korrekte Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum Praxis- bzw. Privatvermögen ist ein zentraler Aspekt der steuerlichen Gestaltung in der Praxisführung. Fehler bei der Einordnung können dazu führen, dass Betriebsausgaben verloren gehen, eine Entnahmebesteuerung erfolgt oder das Finanzamt rückwirkende Korrekturen vornimmt.
Fehlerhafte Zuordnungen können erhebliche Steuerfolgen auslösen – von der Versteuerung stiller Reserven bis zum Verlust von Betriebsausgaben. Besonders in Sonderfällen der Mitunternehmerschaft und bei gemischten Gesellschaften freiberuflich/gewerblich ist sorgfältige Planung unerlässlich.
Unsere Empfehlung: Lassen Sie Ihre Vermögensstruktur regelmäßig prüfen und beraten Sie sich frühzeitig – etwa bei Investitionen, Kooperationen oder Praxisverkäufen.
Für eine individuelle Einschätzung stehen Ihnen unsere Expertinnen Stefanie Anders und Monika Makowski gern zur Seite.