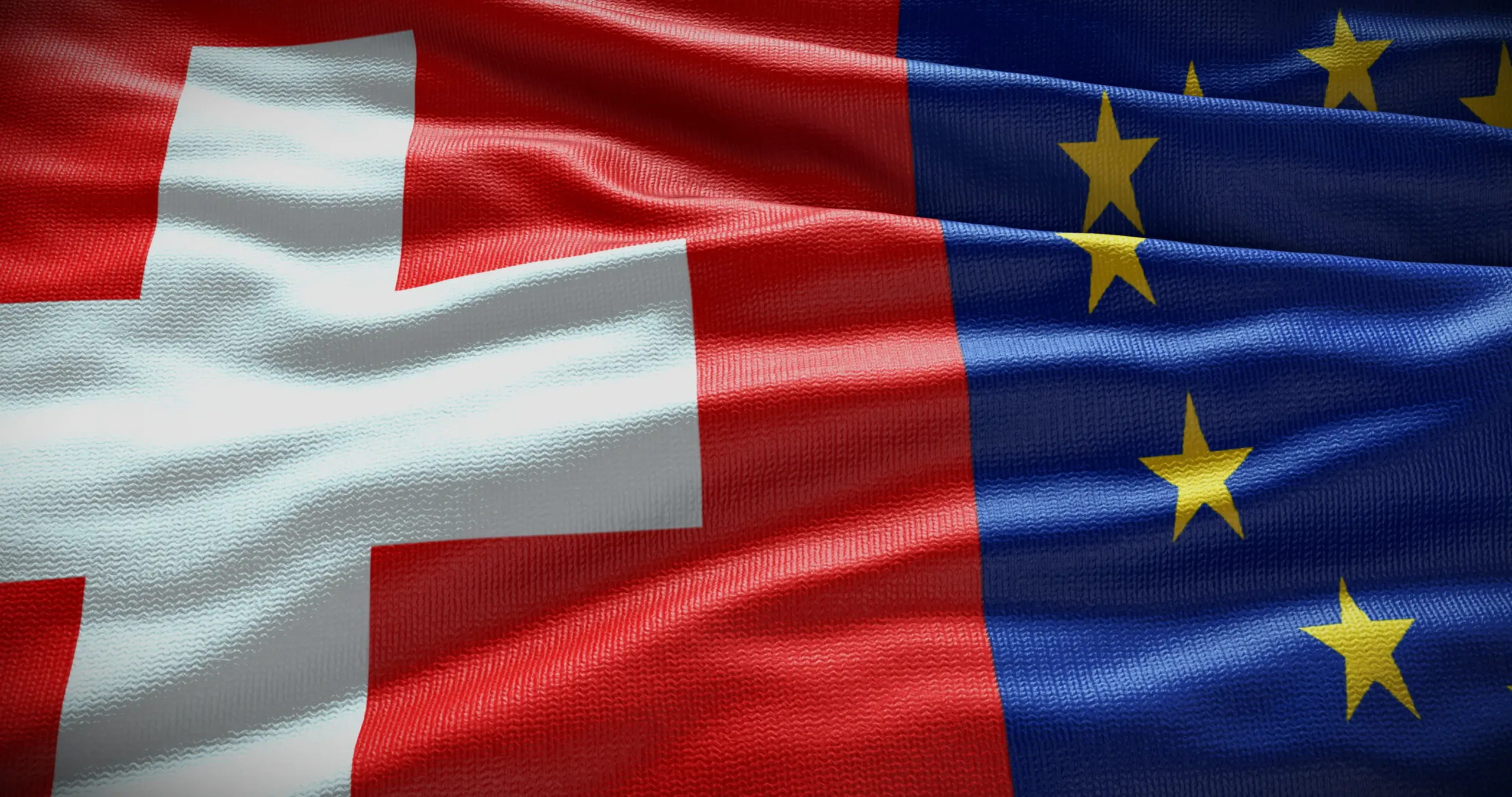7. Juni 2023
Das neue EU-Lieferkettengesetz
Bereits zur Einführung des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes hatten wir an dieser Stelle das Gesetz und den Handlungsbedarf für die Unternehmen dargestellt.
Frühzeitig nahm der deutsche Gesetzgeber eine erwartete EU-Vorgabe in den Blick. Am 1. Juni gab das Europäische Parlament nun sein Votum zum EU-Lieferkettengesetz ab. Dies konkretisiert die EU-Vorgabe, die durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz umgesetzt werden sollte. Sie erfahren in diesem Beitrag mehr über die Anforderungen der europäischen Vorgabe sowie mögliche Strafen bei Nichteinhaltung und unsere Einschätzung zur neuen Vorgabe zum EU-Lieferkettengesetz.
Für wen gilt das EU-Lieferkettengesetz?
Schon beim Anwendungsbereich wird deutlich: Die EU geht weit über das hinaus, was der deutsche Gesetzgeber vorgesehen hat.
Besonders sticht heraus, dass die europäischen Regelungen bereits für EU-Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von über 40 Millionen Euro gelten, wenn mindestens die Hälfte des Umsatzes in sogenannten Risikosektoren, wie der Textilbranche erwirtschaftet wird.
Für Nicht-EU-Unternehmen gelten diese Vorgaben bei einem Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro, wenn mindestens 40 Millionen Euro davon in der EU erwirtschaftet worden sind.
Der Anwendungsbereich des deutschen Gesetzes gilt derzeit ab 3000, oder ab dem 01.01.2024 ab 1000 Mitarbeitern.
Welche Ziele verfolgt die EU-Vorgabe zum Lieferkettengesetz?
Die neuen Vorschriften, wie auch das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, verpflichten Unternehmen zur Verhinderung, Beendigung oder Abmilderung von negativen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Menschenrechte und die Umwelt. Zu den negativen Auswirkungen gehören etwa Kinderarbeit, Sklaverei, Umweltverschmutzung und auch der Verlust biologischer Vielfalt.
Die europäische Vorgabe geht auch in diesem Punkt weiter und sieht auch Sorgfaltspflichten für Unternehmen für die der Lieferkette nachgelagerte Wertschöpfungskette vor.
Die Sorgfaltspflichten beinhalten dabei, dass die Unternehmen auch auf die Berücksichtigung von Menschenrechten und Umwelt durch ihre Partner entlang der Liefer- und Wertschöpfungskette achten müssen. Davon sind keineswegs nur die Zulieferer und direkten Geschäftspartner betroffen, sondern alle, die durch den Verkauf, Vertrieb, Transport oder Lagerung der Produkte in Verbindung stehen.
Neben den dargestellten Sorgfaltspflichten müssen Unternehmen auch weitere Vorgaben umsetzen. Ein zentraler Punkt ist die Aufstellung von Plänen für eine klimaneutrale Wertschöpfungskette bis 2050.
Was sind die Sanktionen bei einem Verstoß?
Auf Unternehmen, die die Vorschriften nicht einhalten, kommen empfindliche Strafen zu. Zum einen drohen immaterielle Strafen. Das sogenannte „Naming and Shaming“ stellt das Unternehmen öffentlich an den Pranger der Öffentlichkeit.
Zum anderen drohen Strafen wie die Rücknahme der Waren vom Markt oder Schadensersatz in Form von Geldstrafen. Diese betragen mindestens 5 % des weltweiten Nettoumsatzes.
Auch ein Ausschluss von der öffentlichen Vergabe von Aufträgen in der EU ist nicht undenkbar.
Sammelklagen von Gewerkschaften oder zivilgesellschaftlichen Organisationen sind zukünftig zulässig, wenn es um die Anzeige von Missständen in der Lieferkette geht.
Für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben werden Unternehmensmanager dann persönlich verantwortlich sein. Bei Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern werden etwa die Bonuszahlungen für Manager an die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gekoppelt.
Unsere Einschätzung
Grundsätzlich sind die ethischen Dimensionen des Handels und die Stärkung des nachhaltigen Konsummodells eine gute Idee. Dafür muss für die Unternehmen ein level playing field geschaffen werden. Das heißt: Alle sind gleichermaßen verpflichtet.
Die von der EU vorgestellten Vorgaben gehen weit über die Regelungen des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes hinaus. Hier muss also in einem großen Umfang nachgeschärft werden.
Die Herausforderungen für den Mittelstand vergrößern sich. Kritiker wenden ein, dass eine Lieferkette aus einer Vielzahl von Unternehmen bestehen kann. Das EU-Gesetz sei deshalb nicht praxistauglich und unverhältnismäßig.
Unser dringender Rat: Bereiten Sie sich jetzt schon auf die anstehenden Änderungen vor und installieren ein wirksames Risikomanagementsystem. An dessen Anfang steht immer die Risikoanalyse. Unsere Wirtschaftsprüfer:innen und Rechtsanwält:innen arbeiten hier eng zusammen und bieten Ihnen so eine breit gefächerte Expertise in diesen neuen Rechtsgebieten aus einer Hand. Sprechen Sie uns gerne an!