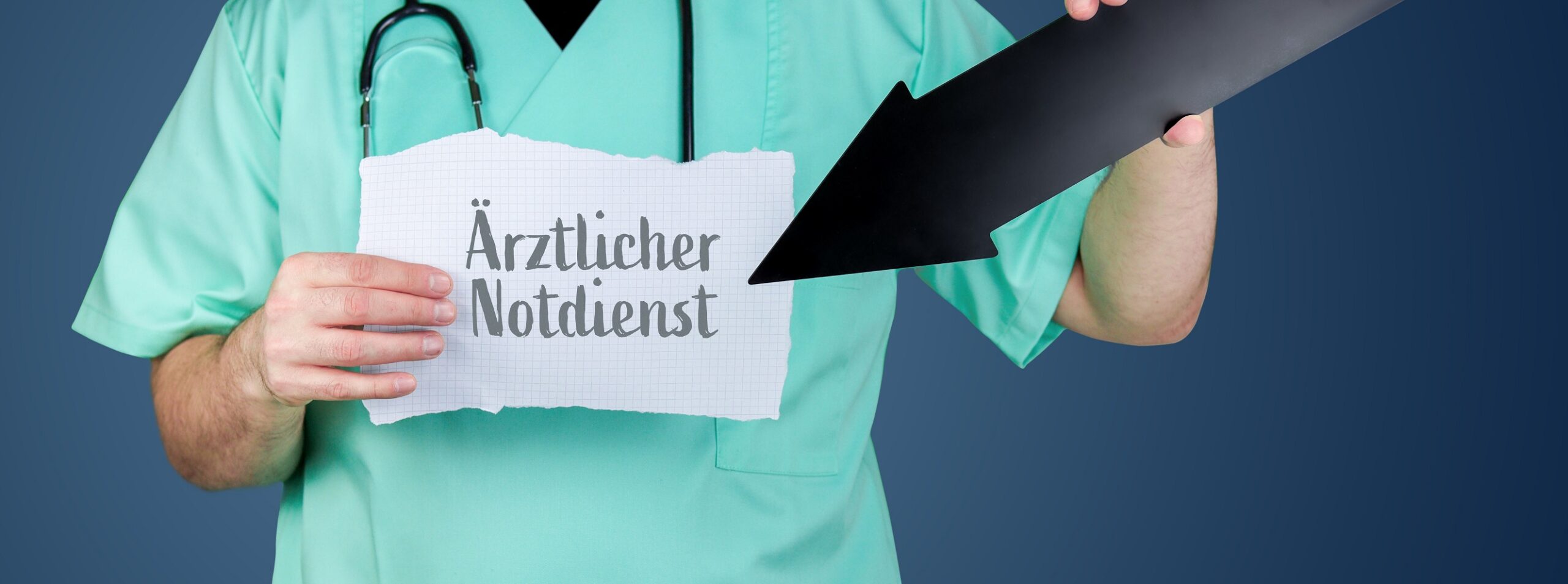27. Oktober 2025
PKW: Leasing oder kaufen? Was für (Zahn-)Ärzt:innen steuerliche Vorteile bringt
Inhaltsverzeichnis
Ob für Hausbesuche, Fahrten zu Fortbildungen oder in die eigenen Praxis Viele Inhaber:innen einer (Zahn-)Arztpraxis benötigen einen eigenen PKW. Doch vor der Anschaffung stellt sich die Frage: Geschäftswagen leasen oder kaufen?
Neben steuerlichen Aspekten spielen Bilanzierung, Liquidität und langfristige Nutzung eine wichtige Rolle. Auch für Freiberufler:innen, die ein Auto leasen möchte, oder für selbstständig Tätige, die überlegen, ob sie ein Auto leasen oder kaufen, stellen sich ähnliche Fragen.
In diesem Beitrag beleuchten wir die wichtigsten Aspekte, vergleichen Kauf und Leasing wirtschaftlich und steuerlich und geben konkrete Hinweise für (Zahn-)Arztpraxen und (Zahn-)Ärzte.
Was ist für die (Zahn-)Arztpraxis günstiger: Leasen oder Kaufen?
Ein Dienstwagen – kaufen oder leasen – ist immer eine strategische Entscheidung.
Beim Kauf geht das Fahrzeug direkt in das Betriebsvermögen der Praxis über. Es stellt Anlagervermögen der Praxis dar und wird über die betriebliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Diese ist gesetzlich festgelegt und beträgt bei einem neuangeschafften PKW sechs Jahre. Bei einer Finanzierung können die Schuldzinsen steuerlich als Praxisausgabe geltend gemacht werden, die Tilgung hingegen nicht. Im Jahr der Anschaffung besteht die Besonderheit, dass die Abschreibung nur zeitanteilig für die verbleibenden Restmonate berücksichtigt werden kann.
Beim späteren Verkauf oder einer Privatentnahme können stille Reserven aufgedeckt werden, die versteuert werden müssen. Dies ist dann der Fall, wenn der Verkaufswert höher als der Restbuchwert ist, also im Laufe der Zeit eine Wertsteigerung stattgefunden hat.
Das Leasing hingegen erfordert im Regelfall keine Anfangsinvestition (sofern keine anfängliche Leasingsonderzahlung vereinbart wurde), schont somit anfänglich Liquidität und bietet planbare Praxiskosten für einen im Vorfeld festgelegten Leasingzeitraum Die monatlichen Raten sind als Praxisausgabe absetzbar. Nachteile: Kilometerbegrenzungen, die bei Überschreitungen mit hohen Kosten verbunden sind und das fehlende Eigentum am Fahrzeug.
Außerdem wird der PKW im Zeitpunkt der Leasingrückgabe noch genau begutachtet. Werden hierbei größere Schäden festgestellt, werden diese nachträglich in Rechnung gestellt.
Besonderheit beim Leasing:
Wird für die ärztliche Tätigkeit die Freiberuflichkeit versagt und diese als gewerblich eingestuft, so müssen 20 Prozent der Leasingraten bei der Ermittlung des der Gewerbesteuer unterliegenden Gewinns hinzugerechnet werden, soweit der Freibetrag von 200.000 Euro überschritten wird. Grundsätzlich üben (Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzte aber einen freien Beruf gemäß § 18 EStG aus und unterliegen daher nicht der Gewerbesteuer, weshalb diese Regelung im Regelfall nicht greift. Wann eine Gewerblichkeit droht, können Sie in einem unser weiteren Blogbeiträge nachlesen. (Gewerblichkeit bei freiberuflicher Mitunternehmerschaft)
Gerade für (Zahn-)Ärzte und andere Freiberufler, die flexibel bleiben wollen, kann Leasing oder ein Modell des Gewerbeleasing für Freiberufler attraktiv sein.
Welche steuerlichen Vorteile bietet Leasing für (Zahn-)Ärzte?
Leasing für (Zahn-)Ärzte bringt den Vorteil, dass alle monatlichen Leasingraten sofort vollständig als Praxisausgabe abzugsfähig sind. Ein Leasingfahrzeug hingegen stellt kein Praxisvermögen dar und wird folglich nicht als solches aktiviert. Die laufenden Kosten, wie Leasingraten, sowie alle weiteren Kosten, die im Zusammenhang mit dem Fahrzeug entstehen (beispielsweise Tanken, Kfz-Versicherung und Kfz-Reparaturen), werden direkt über die Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. Das senkt den steuerpflichtigen Gewinn. Wird das Leasingfahrzeug an den Leasinggeber zurückgegeben, hat dies auch keine Auswirkungen auf die Einnahmen-Überschuss-Rechnung bzw. Bilanz, da diese ebenfalls über die Gewinn- und Rechnung direkt, als Betriebsausgabe berücksichtigt werden. Außerdem spielen stille Reserven beim späteren Fahrzeugwechsel, anders als beim Kauf eines PKWs keine Rolle.
Besonderheit bei (Zahn-)Ärztinnen: Vorsteuer-Thematik:
(Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzte erbringen überwiegend umsatzsteuerfreie Heilbehandlungen gemäß § 4 Nr. 14 UStG. Dadurch, dass bei ihren Behandlungen keine Umsatzsteuer berechnet wird, ist kein Vorsteuerabzug aus Anschaffungs- oder Leasingkosten möglich.
Mit Ausnahme von (Zahn-)Arztpraxen, die neben den von der Umsatzsteuer befreiten Leistungen auch umsatzsteuerpflichtige Leistungen, wie z.B. kosmetische Eingriffe oder auch Gutachterleistungen erbringen, kann anteilig einen Vorsteuerabzug geltend machen. Die Aufteilung des Vorsteuerabzugs erfolgt nach Verhältnis steuerpflichtiger zu steuerfreien Umsätzen gemäß § 15 Abs. 4 UStG.
Welche Kriterien sprechen für den Kauf eines Praxiswagens?
Der Kauf bietet sich vor allem dann an, wenn:
- ausreichend Eigenkapital vorhanden ist,
- die Praxis langfristig von der Nutzung profitieren möchte,
- keine Einschränkungen durch Kilometerbegrenzungen erwünscht sind,
- man als Praxisinhaber:in den PKW auch ggf. über mehrere Jahre nutzen und nicht nach drei Jahren ein neues Modell fahren möchte
Wer also auf Stabilität setzt, fährt mit einem Kauf oft besser. Wer dagegen flexibel bleiben und gerne auch regelmäßig einmal ein neueres Modell fahren möchte, kann als selbständige (Zahn-)Ärztin bzw. Selbständiger (Zahn-)Arzt einen PKW leasen.
Wie beeinflusst der PKW die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) bzw. Bilanz der (Zahn-)Arztpraxis?
Wird ein PKW gekauft und überwiegend für Praxiszwecke genutzt, ist er in das Anlagevermögen der Praxis aufzunehmen. Die Aktivierung erfolgt mit den Anschaffungskosten.
Bei Einnahmen-Überschuss-Rechnern wird der PKW als Anlagevermögen in der Anlage AV EÜR aufgeführt, bei Bilanzierern erfolgt der Ausweis als Anlagevermögen auf der Aktiva-Seite der Bilanz.
Die laufende Abschreibung wird dagegen gerechnet, so dass zum Ende des Jahres noch ein entsprechender Buchwert verbleibt,
Beispiel:
Anschaffung PKW zum 01.09.2025
Anschaffungskosten (brutto): 60.000,00 Euro
Keine Berechtigung zum Vorsteuerabzug
Jährliche Abschreibung: 60.000,00 Euro x 1/6 = 10.000,00 Euro
| Aktivierung in Höhe der Anschaffungskosten (brutto) | 60.000,00 Euro |
| abzgl. Abschreibung 9-12/2025 (zeitanteilig):
10.000,00 Euro x 4/12 = |
3.334,00 Euro |
| Restbuchwert 31.12.2025 | 56.666,00 Euro |
Wird für die Anschaffung des PKW ein Darlehen genommen, so stellt dies Schulden für die Praxis dar, die bei Bilanzieren auf der Passiva-Seite der Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen werden muss.
Die laufenden Schuldzinsen stellen sowohl bei Einnahmen-Überschuss-Rechnern als auch bei Bilanzierern Praxisausgaben dar.
Besonderheit: Kauf-Leasing:
Einige Leasingverträge bieten die Möglichkeit, den PKW nach Ablauf des Leasingvertrags kaufen zu können. Hierdurch wird das Fahrzeug in das Betriebsvermögen aufgenommen und wie ein “normaler” Kauf behandelt.
Welche Fehler sollte man bei der Fahrzeuganschaffung in der Praxis vermeiden?
- Nur auf den Kaufpreis schauen: Neben den Anschaffungskosten sind laufende Betriebskosten, Versicherungen, Steuern und mögliche Restwerte zu berücksichtigen
- Steuerliche Aspekte ignorieren: Wer Umsatzsteuer nicht abziehen darf, hat beim Bruttolistenpreis höhere Belastungen als gedacht. Dies wirkt sich auch auf das Finanzierungsvolumen bei der Bank aus.
- Privatnutzungen nicht korrekt erfassen: Die 1 %- Regelung oder das Fahrtenbuch sind Pflicht – falsche oder fehlende Angaben führen zu Steuernachzahlungen
- Falsche Vertragswahl beim Leasing: Zu niedrige Kilometergrenzen oder unflexible Vertragsbedingungen können teuer werden
Eigenverbrauch für private PKW-Nutzung/ Besonderheiten bei Elektro- und Hybridfahrzeugen:
Unabhängig davon, ob es sich um einen Kauf oder um Leasing eines PKWs handelt – sobald dieser auch privat genutzt wird, greift die sogenannte “1 %-Regelung” oder das Fahrtenbuchverfahren. Bei der 1 %- Regelung wird grds. monatlich 1 % des Bruttolistenneupreises als fiktive Praxiseinnahme berücksichtigt und somit gewinnerhöhend berücksichtigt. Für einige Elektrofahrzeuge und bestimmte Plug-in-Hybride gilt ein reduzierter Bruttolistenpreis als Bemessungsgrundlage. Für reine E-Autos mit einem Bruttolistenpreis bis zu 60.000 Euro gilt seit 2020 die 0,25 %- Regelung. Für E-Autos mit einem Bruttolistenpreis von über 60.000 Euro sowie für Plug-in-Hybride gilt die 0,5 %-Regelung. Dies führt dazu, dass die Privatnutzung des Fahrzeugs nur mit einem Viertel oder der Hälfte des regulären Ansatzes versteuer wird – ein deutlich steuerlicher Vorteil gegenüber Verbrennern.
Doch Achtung! Die 1 %- Regelung orientiert sich am Bruttolistenpreis des Fahrzeugs – unabhängig von den tatsächlichen Kosten, Kaufpreis oder Leasingrate. Das kann in der Praxis dazu führen, dass der pauschale Nutzungswert höher ist als die tatsächlich entstandenen Kosten. Dies ist insbesondere bei älteren Gebrauchtwagen, günstigen Leasingverträgen, oder bei E-Autos mit niedrigen Betriebskosten der Fall. Um eine Überbesteuerung zu vermeiden, hat die Rechtsprechung und Finanzverwaltung festgelegt, dass der geldwerte Vorteil aus der Privatnutzung nicht höher sein darf als die gesamten Kfz-Kosten, die tatsächlich anfallen (sogenannte “Kostendeckeldung”). Zu diesem Kosten zählen Abschreibung, Finanzierungskosten, Reparatur, Wartung, Versicherung, Kfz-Steuer, Kraftstoff (oder Strom bei E-Autos).
Unsere Einschätzung
Auf die Frage “Leasen oder kaufen?” gibt es keine pauschale Antwort.
Während Leasing für viele (Zahn-)Arztpraxen die Liquidität schont und steuerlich unkompliziert ist, bietet der Kauf langfristig Stabilität und Vermögensaufbau, setzt aber Kapitalbindung voraus.
Wichtig ist, die Entscheidung nicht allein vom Anschaffungspreis abhängig zu machen. Steuerliche Rahmenbedingungen, die Art der Nutzung, geplante Laufzeiten sowie die individuelle Finanzsituation der Praxis spielen eine zentrale Rolle. Auch Besonderheiten, wie die 1 %- Regelung, oder die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs können das Ergebnis erheblich beeinflussen.
Unser Rat: Prüfen Sie vor einer Entscheidung die Auswirkungen auf Bilanz, Liquidität und Steuerlast. So stellen Sie sicher, dass Ihr Praxisfahrzeug nicht nur mobil macht, sondern auch wirtschaftlich optimal eingesetzt wird. Gerne stehen Ihnen Stefanie Anders und ihr Team bei dieser Entscheidung zur Seite.