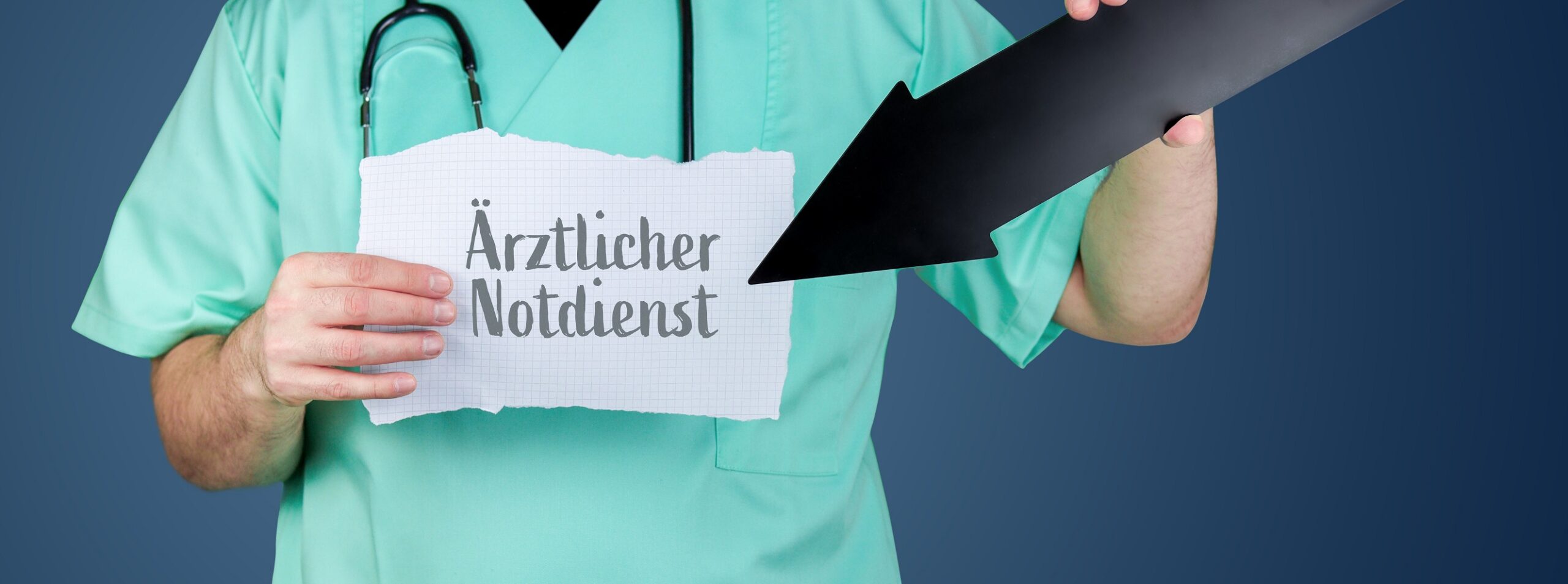22. Juli 2025
BGH zur Testierfreiheit: Ärzt:innen dürfen Vermächtnisse annehmen
Inhaltsverzeichnis
Mit Urteil vom 16. April 2024 (Az. IV ZR 93/22) hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein vielbeachtetes Signal zur Testierfreiheit von Patient:innen und deren Verhältnis zur ärztlichen Berufsordnung gesetzt. Die Entscheidung: Ärzt:innen dürfen testamentarisch als Erb:innen oder Vermächtnisnehmer:innen bedacht werden – selbst dann, wenn die Berufsordnung ihrer Ärztekammer dies grundsätzlich untersagt. Die verfassungsrechtlich garantierte Testierfreiheit steht über dem berufsrechtlichen Zuwendungsverbot.
Der IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat mit seinem Urteil vom 16. April 2024 eine weitreichende Klarstellung im Spannungsfeld zwischen der verfassungsrechtlich geschützten Testierfreiheit und den berufsrechtlichen Pflichten von Ärzt:innen getroffen. Die Entscheidung bekräftigt, dass ein Testament zugunsten des behandelnden Arztes bzw. Ärztin nicht per se unwirksam ist, selbst wenn ein Verstoß gegen die ärztliche Berufsordnung vorliegt. Für die erbrechtliche Praxis bedeutet dies eine Verschiebung der Maßstäbe bei der Beurteilung der Sittenwidrigkeit solcher Verfügungen von Todes wegen.
Dem Verfahren lag der Fall einer Patientin zugrunde, die ihrem Hausarzt testamentarisch ein Grundstücksvermächtnis zugewandt hatte. Die Ärztekammer wertete dies als Verstoß gegen § 32 MBO-Ä, der die Annahme von Zuwendungen untersagt, sofern dadurch der Eindruck einer unsachlichen Einflussnahme auf das ärztliche Handeln entstehen kann. Die zentrale Rechtsfrage war, welche zivilrechtlichen Konsequenzen ein solcher Berufsrechtsverstoß auf die Wirksamkeit des Testaments hat.
Im Kern standen sich zwei Rechtsgüter gegenüber
- Die Testierfreiheit des Erblassers, als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 GG) und geschützt durch die Erbrechtsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG).
- Das berufsrechtliche Zuwendungsverbot, das die Integrität der Ärzteschaft und das Vertrauen der Patienten schützen soll.
Anfechtende Erben argumentieren in solchen Fällen regelmäßig mit der Nichtigkeit des Testaments, entweder wegen eines Gesetzesverstoßes (§ 134 BGB i.V.m. der berufsständischen Vorschrift) oder wegen Sittenwidrigkeit (§ 138 Abs. 1 BGB). Der BGH erteilte der Anwendung des § 134 BGB eine klare Absage. Die ärztliche Berufsordnung ist kein formelles Gesetz, dessen Verletzung automatisch zur zivilrechtlichen Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts eines Dritten (des Patienten) führt. Die Testierfreiheit kann auf der Grundlage einer Berufsordnung nicht eingeschränkt werden.
Der entscheidende Prüfungsmaßstab ist und bleibt dagegen § 138 Abs. 1 BGB (Sittenwidrigkeit). Ein Testament ist dann nichtig, wenn es gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt.
Der BGH hat hierzu folgende Leitsätze aufgestellt:
- Keine automatische Sittenwidrigkeit: Die bloße Tatsache, dass ein Patient seinen Arzt testamentarisch bedenkt, begründet für sich genommen noch keine Sittenwidrigkeit.
- Indizwirkung des Berufsrechtsverstoßes: Ein Verstoß des Arztes gegen seine Berufsordnung ist ein starkes, aber widerlegliches Indiz dafür, dass eine unzulässige Beeinflussung stattgefunden haben könnte. Es begründet jedoch keine Vermutung der Sittenwidrigkeit.
- Maßgeblichkeit des Einzelfalls: Für die Feststellung der Sittenwidrigkeit müssen weitere, gravierende Umstände hinzutreten. Die anfechtenden Parteien tragen hierfür die volle Darlegungs- und Beweislast. Sie müssen nachweisen, dass der Arzt seine Vertrauensstellung aktiv ausgenutzt, eine psychische Zwangslage geschaffen oder den Willen des Erblassers auf andere Weise unzulässig manipuliert hat.
Was bedeutet das BGH-Urteil für die ärztliche Berufsordnung?
Im Zentrum des Verfahrens stand § 32 der Musterberufsordnung für Ärztinnen und Ärzte (MBO-Ä). Diese Vorschrift untersagt es Mediziner:innen, Zuwendungen von Patient:innen anzunehmen, sofern dadurch der Anschein unsachlicher Einflussnahme entsteht. Im entschiedenen Fall vermachte eine Patientin ihrer Hausärztin ein Grundstück. Die Ärztekammer beanstandete dies als berufsrechtswidrig – doch der BGH sah das anders.
Das Gericht betonte: Die Testierfreiheit ist Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) und kann nicht durch eine berufsrechtliche Vorschrift eingeschränkt werden. Die ärztliche Berufsordnung darf daher nicht verhindern, dass Patient:innen eigenverantwortlich über ihr Vermögen von Todes wegen verfügen – auch wenn die empfangende Person in einem Behandlungsverhältnis steht.
Testierfreiheit versus berufsrechtliches Zuwendungsverbot
Das Urteil stärkt sowohl die Rechte von Patient:innen als auch die Rechtssicherheit von Ärzt:innen. Es macht deutlich: Ein Testament oder Vermächtnis zugunsten einer behandelnden Ärztin oder eines behandelnden Arztes ist nicht automatisch sittenwidrig oder standesrechtlich unzulässig. Entscheidend ist vielmehr, dass der letzte Wille frei, unbeeinflusst und rechtssicher dokumentiert wurde.
Für Ärzt:innen bedeutet das: Sie dürfen Zuwendungen annehmen – allerdings nur, wenn keine Anzeichen für Druck, Abhängigkeit oder unangemessene Einflussnahme vorliegen. Es bleibt also bei einer Einzelfallprüfung, aber die pauschale Untersagung solcher Erbfälle durch die Ärztekammer ist nach Ansicht des BGH nicht haltbar.
Ein wichtiger Aspekt für die Rechtssicherheit von Ärzten ist die Beweislast. Nicht der begünstigte Arzt muss die Rechtmäßigkeit des Testaments beweisen. Vielmehr müssen diejenigen, die das Testament anfechten (z. B. enterbte Verwandte), die Tatsachen darlegen und beweisen, die zur Sittenwidrigkeit führen – also etwa die konkrete Ausnutzung einer Zwangslage.
BGH: Keine automatische Sittenwidrigkeit bei Erbeinsetzung von Ärzt:innen
Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang klargestellt: Allein die Tatsache, dass ein:e Patient:in den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin testamentarisch bedenkt, reicht nicht aus, um eine Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB anzunehmen. Auch ein möglicher Verstoß gegen berufsrechtliche Vorgaben führt nicht automatisch zur erbrechtlichen Unwirksamkeit des Testaments. Damit hebt das Gericht die Hürde für eine erfolgreiche Anfechtung durch Angehörige deutlich an und stärkt die Testierfreiheit der Patient:innen.
Welche Folgen hat das Urteil für Patient:innen und Ärzt:innen?
Das BGH-Urteil hat konkrete Auswirkungen auf den ärztlichen Alltag sowie auf die Nachlassplanung. Für Patient:innen bedeutet es: Sie dürfen ihre:n Ärzt:in im Testament bedenken, wenn sie dies ausdrücklich und selbstbestimmt wünschen. Ärzt:innen wiederum können eine solche Zuwendung annehmen – sollten aber auf rechtliche Absicherung achten. Dazu zählt beispielsweise:
- Der Nachweis, dass das Testament ohne Einflussnahme erstellt wurde
- Eine unabhängige Beratung (z. B. durch Notar:innen oder Rechtsanwält:innen)
- Dokumentation der Beziehung zur Patient:in (Dauer, Art der Betreuung etc.)
Damit reduziert sich das Risiko berufsrechtlicher Auseinandersetzungen deutlich – insbesondere dann, wenn keine anderen Angehörigen vorhanden sind oder ein besonderes Vertrauensverhältnis bestand.
Berufsrechtliche Grenzen bleiben – aber sie sind enger definiert
Trotz der Stärkung der Testierfreiheit bleibt das ärztliche Berufsrecht relevant. Ärzt:innen dürfen nach wie vor keine aktiven Aufforderungen zur Testamentsgestaltung aussprechen oder sich Zuwendungen „erbitten“. Auch weiterhin gilt: Der Schutz vor unsachlicher Einflussnahme muss gewährleistet bleiben – das schließt manipulative oder psychologisch ausnutzende Situationen aus.
Ungeachtet der erweiterten Testierfreiheit kommt es weiterhin auf den Einzelfall an. Eine testamentarische Verfügung kann für sittenwidrig erklärt werden, wenn konkrete Anzeichen für eine unzulässige Einflussnahme vorliegen. Gerichte prüfen hierbei insbesondere folgende Verdachtsmomente:
- Hat der Arzt die Erstellung des Testaments aktiv beeinflusst oder gefördert?
- Wurde das Testament in einer psychischen Ausnahmesituation der Patientin oder des Patienten verfasst (z. B. kurz nach einer niederschmetternden Diagnose)?
- Werden durch die Erbeinsetzung nahe Familienangehörige ohne nachvollziehbaren Grund übergangen?
- Steht die Höhe der Zuwendung in einem auffälligen Missverhältnis zur Dauer und Intensität der Arzt-Patienten-Beziehung?
Für Ärztekammern bedeutet das Urteil, dass pauschale Verbotsnormen verfassungsrechtlich unzulässig sind. Stattdessen bedarf es differenzierter, verfassungskonformer Regelungen, die tatsächliche Missbrauchsfälle sanktionieren – nicht aber das freie Testament einer Patientin oder eines Patienten.
Rechtssicherheit durch frühzeitige Beratung: Unsere Einschätzung
Das Urteil schafft neue Spielräume – aber auch Beratungsbedarf. Wenn Ärzt:innen testamentarisch bedacht werden, sollten sie frühzeitig klären, ob die Annahme rechtlich und steuerlich unproblematisch ist. Um Risiken zu vermeiden, empfehlen wir:
- eine unabhängige Prüfung des Testaments auf Form und Inhalt
- rechtliche Begleitung bei der Annahme der Zuwendung
- steuerliche Bewertung des Vermächtnisses – insbesondere bei Immobilien oder größeren Werten
- transparente Kommunikation mit der Ärztekammer bei Unsicherheiten
Ein notarielles Testament bietet besonders hohe Rechtssicherheit, da es die Testierfähigkeit und Willensfreiheit dokumentiert. Ärzt:innen sollten darüber hinaus ihre Beziehung zur Patientin oder zum Patienten genau dokumentieren und die Zuwendung juristisch wie steuerlich prüfen lassen.
Bei ECOVIS KSO stehen Ihnen unsere spezialisierten Ansprechpartner:innen zur Seite:
- Rechtsanwalt Carsten Meier – Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
- Steuerberaterin Stefanie Anders – spezialisiert auf die steuerliche Betreuung von Heilberufler:innen und MED-Mandant:innen
- Steuerberater Akram Juja – Ihr Experte für Nachfolgeplanung, Erbschafts- und Schenkungsteuer
Sprechen Sie uns gern an – wir unterstützen Sie mit Fingerspitzengefühl, Fachkompetenz und Weitblick.